Europaweite Umfrage zum Thema Korruption
19.07.2011 — Online-Redaktion Verlag Dashöfer. Quelle: Ernst und Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H..
Europaweit geben zwei Drittel der Befragten an, dass Korruption in ihren Ländern nach wie vor gängige Praxis ist – besonders hoch ist der Anteil in den Emerging Markets. In Deutschland sind 45 Prozent der Beschäftigten der Meinung, dass es im Geschäftsleben häufig zu Korruption kommt.
Etwa 60 Prozent aller Befragten gehen davon aus, dass es ihre Führungskräfte in schwierigen Zeiten mit der Moral nicht so genau nehmen, um geschäftliche Ziele zu erreichen. Diese Meinung teilen sogar 78 Prozent der befragten Vorstände und Geschäftsführer. Das sind Ergebnisse einer Umfrage der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young unter 2300 Beschäftigten aus 25 europäischen Ländern.
„Offenbar gibt es immer noch erhebliche Unterschiede zwischen den Anti-Korruptions-Bemühungen, mit denen viele Unternehmen sich brüsten, und der Praxis im Unternehmensalltag“, stellt Stefan Heißner fest, Leader Fraud Investigation & Dispute Services EMEIA Central Zone bei E&Y. „Angesichts der immer schärferen Rechtslage in wichtigen Ländern, in denen diese Unternehmen aktiv sind, ist das nicht ungefährlich – zum Beispiel in Großbritannien und Spanien.“
Korruption bei deutschen Unternehmen weniger verbreitet
Offenbar gibt es einen Zusammenhang zwischen Korruptions-Toleranz und der Intensität, mit der die Unternehmen in den verschiedenen Ländern unter der Krise gelitten haben. Darauf deuten einige Ergebnisse aus Deutschland hin, das diese Phase insgesamt besser überstanden hat als viele andere Nationen. Während in ganz Europa 27 Prozent der Befragten befürchten, dass noch mehr Firmen in finanzielle Nöte geraten, sind es in Deutschland nur 4 Prozent.Der geringere Druck schlägt sich augenscheinlich in einer höheren Moral bei deutschen Unternehmen nieder: Nur 3 Prozent der deutschen Topmanager und 12 Prozent des übrigen Personals halten Schmiergelder für legitime Mittel der Geschäftsausweitung – 2009 war noch jeder Vierte so verständnisvoll. In Europa sind es in diesem Jahr 18 Prozent der Topmanager und 17 Prozent der übrigen Mitarbeiter. Mit den strengeren Maßstäben hat sich auch eine andere Wahrnehmung des Umfelds eingestellt. Während europaweit 65 Prozent der Befragten die Bestechung als weit verbreitetes Vorgehen einstufen, sind es in Deutschland 45 Prozent. Und nur 14 Prozent der Deutschen beobachten Schmiergeldzahlungen in der eigenen Branche – der europäische Durchschnitt liegt doppelt so hoch.
Unternehmen verstärken Anti-Korruptionsmaßnahmen
„Es ist unübersehbar, dass sich in Deutschland einiges getan hat“, urteilt Heißner. „Offenbar haben Bestechung und Korruption nicht mehr das Image von Kavaliersdelikten, sondern von eindeutig kriminellen Handlungen.“ Das sei sicherlich eine Folge dessen, wie Staatsanwälte und Richter, die Öffentlichkeit und nicht zuletzt die Firmen selbst mit solchen Straftaten umgegangen seien: „Inzwischen betreiben viele Unternehmen aktive Prävention. Zum Beispiel beobachten wir in Deutschland einen ganz klaren Aufwärtstrend bei den Anti-Korruptions-Trainings.“ Gut 15 Prozent der Befragten geben in diesem Jahr an, an solchen Schulungs-Maßnahmen teilgenommen zu haben. Vor zwei Jahren waren es immerhin auch schon 11 Prozent.Der rigidere Umgang mit den geschäftsfördernden Maßnahmen hat seine Wirkung nicht verfehlt. Heute sind 90 Prozent der deutschen Mitarbeiter überzeugt, dass die Staatsanwaltschaften ernsthaft gewillt sind, Fehlverhalten zu verfolgen. Mit dieser Auffassung steht Deutschland gemeinsam mit Norwegen auf dem dritten Platz unter den Top Fünf der Rechtsbewussten, nach Schweden und der Schweiz und vor Großbritannien. Schlusslichter dieser Rangliste sind Russland, Tschechien, Kroatien, die Ukraine und Irland.
„Solche regionalen Unterschiede sind oft kulturell oder historisch bedingt“, erläutert Heißner. „In vielen Ländern existiert kein Unrechtsempfinden, weil es seit Jahrhunderten üblich ist, dass eine Hand die andere wäscht. Dort wird es noch einige Zeit dauern, bis sich eine Compliance-Kultur durchsetzt.“ Auch das wird in der Studie erkennbar. Während 46 Prozent der Beschäftigten in den entwickelteren Staaten Korruption als weit verbreitet ansehen, sind es in den Emerging Markets 81 Prozent.
Ähnlich die Relationen bei der Frage nach der eigenen Branche: In den meist westlichen Industrieländern konzedieren 20 Prozent der Befragten Schmierpraktiken im eigenen Umfeld, in den Emerging Markets sind es 38 Prozent, fasst doppelt so viele. Heißner ist davon überzeugt: „Historisch betrachtet kann man sagen, je internationaler die Geschäfte der Unternehmen aus diesen Ländern werden, um so mehr werden auch sie sich internationalen Standards anpassen müssen. Wir haben diesen Prozess schon weitgehend hinter uns.“
Mitarbeiter fordern stärkere Überwachung und Sanktionen
Doch selbst die Unternehmen in den entwickelten Märkten tun sich nicht immer leicht, eine wirksame Kultur der Rechtschaffenheit zu installieren. Es spricht für sich, dass 45 Prozent der Befragten in Europa für eine verstärkte Überwachung durch die Aufsichtsorgane sind, 31 Prozent plädieren sogar dafür, dass Behörden und Regulierer ihr eigenes Unternehmen genauer unter die Lupe nehmen sollten.Hier signalisieren die deutschen Zahlen – 16 Prozent für die generell verstärke Überwachung, 13 Prozent für verschärfte Aufsicht im eigenen Unternehmen – abermals, dass das Vertrauen in die Wirksamkeit der internen und externen Maßnahmen vergleichsweise groß ist. Aber: Auch in Deutschland haben nur rund 50 Prozent der Unternehmen Verhaltenscodices und definierte Anti-Korruptions-Richtlinien. Weniger als die Hälfte der Mitarbeiter glauben, dass die Strafen für Verstöße gegen solche Richtlinien klar geregelt sind. Und nur 44 Prozent der befragten Deutschen meinen, dass moralisches Verhalten bei der Beurteilung ihrer Leistungen eine Rolle spielt.
„Mit der Unternehmenskultur ist das so eine Sache. „Da formulieren 56 Prozent der europäischen Unternehmen für sich Anti-Korruptionsgrundsätze und nur ein Teil davon definiert auch klare Sanktionen“, urteilt Heißner. „Das System muss so gestaltet werden, dass im Ernstfall auch sanktioniert wird. Anders kann das Verhalten der Mitarbeiter nicht geändert werden. Vielleicht verschlimmert man es sogar noch damit.“
Korruption wird (zu) selten geahndet
Doch nur gut ein Viertel – in Deutschland sogar nur ein Fünftel – der Befragten berichtet davon, dass Kollegen im Unternehmen für Korruptionsdelikte tatsächlich bestraft wurden. Ebenso wenig trägt es zur Motivation bei, wenn fast 60 Prozent der Befragten (und die Hälfte der Führungskräfte selbst) meinen, dass ihr Management es mit dem Recht nicht mehr so genau nehmen würde, ginge es darum, in diesen schwierigen Zeiten geschäftliche Zielvorgaben zu erreichen.Jeder zweite - in den Emerging Markets zwei Drittel – meint, dass die Korruption viel zu verbreitet ist, um ihr beikommen zu können. Stark vertreten sind zudem die Meinungen, dass Behörden und Regulierer nicht mit ausreichender Gesetzesmacht und mit genügenden Ressourcen ausgestattet sind.
„Um die Bekämpfung der Korruption in Unternehmen ist es in ganz Europa, auch in Deutschland, noch nicht wirklich gut bestellt“, zieht Heißner das Fazit. „Und vielerorts scheint der Wille dazu unter dem Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse ebenso zurück zu gehen wie das Budget, das dafür zur Verfügung steht. Es kann aber nicht sein, dass rechtskonformes Verhalten eine Sache der Konjunktur ist. Und Solange die Führungskräfte keine glaubwürdigen Vorbilder abgeben, ist die Schlacht gegen Schmiergelder, Kickbacks und inadäquate Geschenke ohnehin nicht zu gewinnen.“
Quelle:

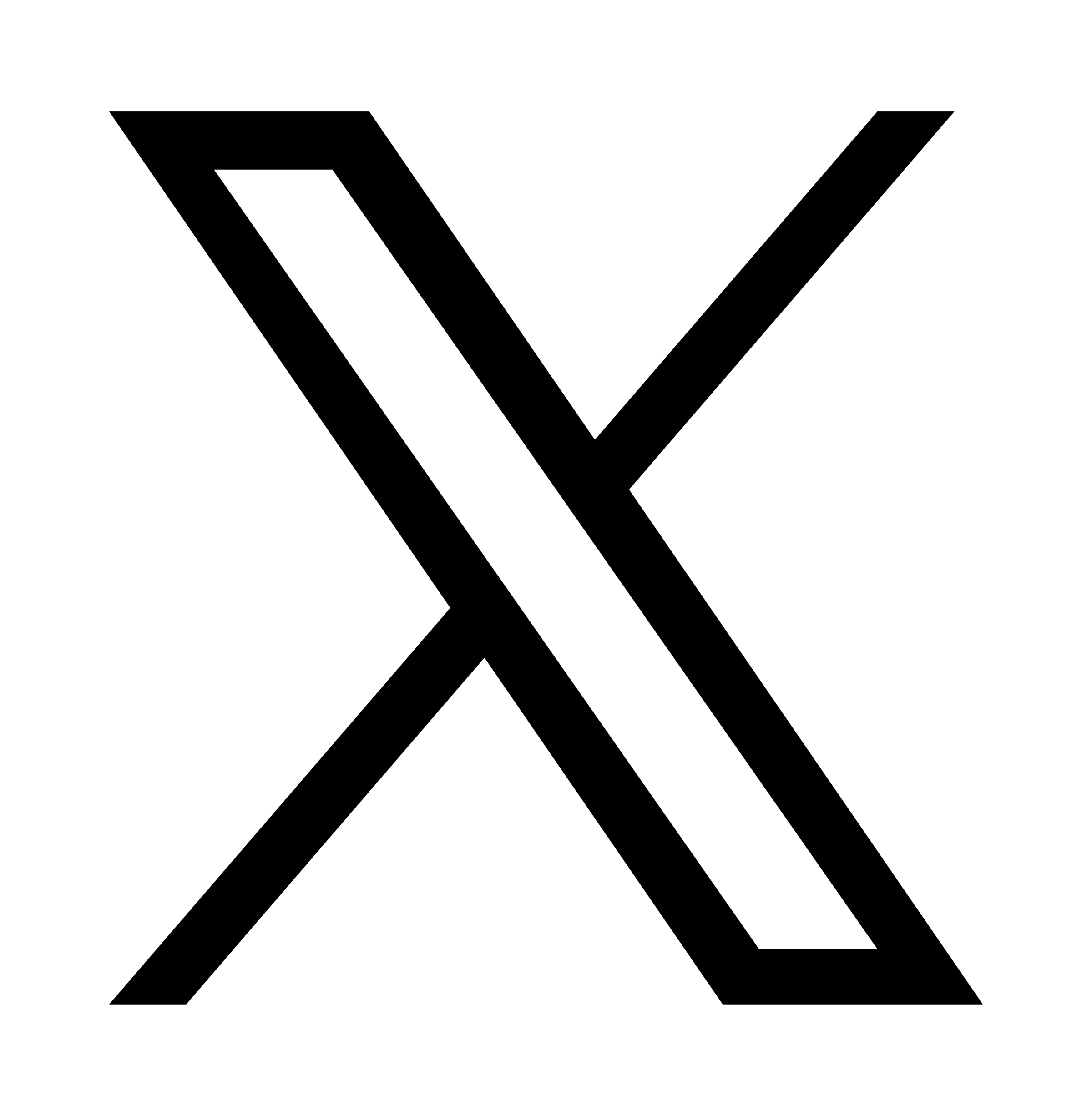 X
X
