Die EDV-Software zählt zu den immateriellen Vermögensgegenständen, die nach § 266 Abs. 2 A. I. HGB im Anlagevermögen auszuweisen sind. Diese immateriellen Vermögensgegenstände können einerseits selbst geschaffen sein (dann besteht ein Aktivierungswahlrecht nach § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB) oder andererseits entgeltlich erworben werden (dann besteht eine Aktivierungspflicht).
Wird EDV-Software für einen Kunden hergestellt und es liegt ein Werkvertrag zugrunde, dann besteht zum Bilanzstichtag handelsrechtlich eine Aktivierungspflicht. Der Ausweis erfolgt unter dem Posten Vorräte, § 266 Abs. 2 B. I. HGB.
Die EDV-Software zählt zu den immateriellen Vermögensgegenständen, die nach § 266 Abs. 2 A. I. HGB im Anlagevermögen auszuweisen sind. Diese immateriellen Vermögensgegenstände können einerseits selbst geschaffen sein (dann besteht ein Aktivierungswahlrecht nach § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB) oder andererseits entgeltlich erworben werden (dann besteht eine Aktivierungspflicht).
Wird EDV-Software für einen Kunden hergestellt und es liegt ein Werkvertrag zugrunde, dann besteht zum Bilanzstichtag handelsrechtlich eine Aktivierungspflicht. Der Ausweis erfolgt unter dem Posten Vorräte, § 266 Abs. 2 B. I. HGB.
EDV-Software – die drei Bereiche
Firmware: Software, die fest mit dem Computer verbunden ist, z. B. BIOS.
Systemsoftware: Programme, die Ressourcen eines Computers verwalten, Befehle des Anwenders ausführen und Programmabläufe steuern. Können jederzeit gelöscht und durch andere Systemsoftware ersetzt werden.
Anwendungssoftware: alle Programme, die der Datenverarbeitung dienen. Kann individuell auf die Bedürfnisse des Anwenders zugeschnitten (Individualsoftware) oder aber für eine Vielzahl von Anwendern konzipiert sein (Standardsoftware).
Ansatz dem Grunde nach
EDV-Software gehört zu den immateriellen Vermögensgegenständen und ist damit selbstständig bilanzierungsfähig. Hingegen zählt die Firmware als unselbstständiger Teil der Hardware und mit dieser zusammen zum Sachanlagevermögen. Ebenso ist die Systemsoftware nicht ohne die entsprechende Hardware verwendbar und damit als unselbstständig anzusehen. Wird eine Systemsoftware zusammen mit der Hardware entgeltlich erworben (sog. Bundling), so ist eine Aufteilung der Anschaffungskosten nicht notwendig, da die Hardware zusammen mit der Software einen einheitlichen Vermögensgegenstand des Sachanlagevermögens bildet.
Diese bilanzrechtliche Betrachtungsweise unterscheidet sich von der zivilrechtlichen dahingehend, dass für die zivilrechtlichen Gewährleistungsfragen zwischen der körperlichen Hardware und dem urheberrechtlich geschützten immateriellen Vermögensgegenstand der Software unterschieden wird.
Ein immaterieller Vermögensgegenstand liegt nicht vor, sofern die Funktion des Datenträgers beziehungsweise der Datei sich ausschließlich auf das Vorhalten der gespeicherten Daten erstreckt und durch diese keine Abläufe gesteuert werden. Hierunter fällt auch die Ausführung einfacher Suchfunktionen. Im Ergebnis stellt ein solches Programm einen materiellen Vermögensgegenstand dar. Aus Vereinfachungsgründen können die ertragsteuerrechtlichen Regelungen zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern in diesem Zusammenhang in Anspruch genommen werden.
Kommt es zu einer Überlassung der Software im Rahmen eines Mietvertrags und wird im Voraus ein Entgelt hierfür entrichtet, so ist ein Rechnungsabgrenzungsposten nach § 250 Abs. 1 HGB zu bilden und in den nachfolgenden Perioden verursachungsgerecht aufzulösen. Wird die Software im Rahmen eines Leasing-Geschäfts überlassen, so gelten die allgemeinen Grundsätze des Leasings.
Die Zugangsbewertung erfolgt mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Eine Anschaffung liegt vor, wenn nach dem Willen der Vertragsparteien die wirtschaftliche Verfügungsmacht über den Vermögensgegenstand auf den Erwerber übergehen soll. Ab diesem Zeitpunkt hat der Erwerber den Vermögensgegenstand zu bilanzieren. Damit liegt das Herstellungs- und Funktionsrisiko beim Veräußerer. Ebenso ist ein Anschaffungsvorgang gegeben, wenn mit dem Softwareanbieter ein Werkvertrag (§§ 631 – 651 BGB) geschlossen wird und die Projektleitung beim Softwareanbieter liegt und dieser sich für die Verwendbarkeit der Software verpflichtet hat. Auch ein Mitwirken von Mitarbeitern des Softwareanwenders ändert dieses Ergebnis nicht.
Liegt das Herstellungs- und Funktionsrisiko beim Erwerber, so hat der Erwerber Herstellungskosten. Steht bei einer Auftragsproduktion dem Auftragnehmer das Schutzrecht zu, so ist dieser Hersteller, wohingegen der Auftraggeber das vertraglich vereinbarte Recht erwirbt und damit bei ihm ein Anschaffungsvorgang vorliegt. Ein Herstellungsvorgang i. S. d. § 255 Abs. 2 HGB liegt vor, wenn die Software unter Einsatz eigener materieller und personeller Ressourcen selbst erstellt wird. Eine Herstellung ist auch dann gegeben, wenn der Softwareanwender mit dem Softwareanbieter einen Dienstvertrag (§§ 611 – 630 BGB) eingeht und somit der Softwareanwender das wirtschaftliche Risiko der Herstellung trägt.
Kommt es nach dem Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung der Software zu einer wesentlichen Verbesserung, besteht im Rahmen der Anschaffung eine Aktivierungspflicht, wohingegen im Bereich der Herstellung, sofern die Software im Anlagevermögen genutzt wird, ein Aktivierungswahlrecht besteht, § 255 Abs. 2a HGB.
Software-Update?
Kosten für Updates und Releasewechsel stellen laufenden Erhaltungsaufwand dar, sofern diese die Funktionsfähigkeit der bestehenden Software aufrechterhalten. Jedoch kann unter Umständen ein neuer Vermögensgegenstand vorliegen, sofern die bestehende Programmversion einer tiefgreifenden Überarbeitung unterzogen wurde. Hierbei ist wiederum zu unterscheiden, ob es sich um einen Anschaffungs- oder Herstellungsvorgang handelt.
Entstehen Aufwendungen für das so genannte Customizing, ist zu unterscheiden, ob diese Maßnahmen dazu dienen, einen betriebsbereiten Zustand zu erreichen oder aber ob es sich um eine Ergänzung der Standardkonfiguration handelt. Maßnahmen, die der Erreichung des betriebsbereiten Zustandes dienen, sind zu aktivieren. Darüber hinausgehende Maßnahmen sind als Herstellungskosten zu beurteilen, sofern der Softwareanwender das Herstellungsrisiko trägt.
Ansatz der Höhe nach
Zum Umfang der Anschaffungskosten vgl. § 255 Abs. 1 HGB. Der Anschaffungszeitpunkt ist der Zeitpunkt der Lieferung, d. h. der Zeitpunkt des Übergangs von Besitz, Nutzen und Lasten auf den Erwerber. Die Anschaffungskosten können sowohl vor als auch nach dem Anschaffungszeitpunkt anfallen. Nicht zu den Anschaffungskosten gehören Aufwendungen für allgemeine Organisationsberatung, die Entwicklung von Grobkonzepten sowie die Analyse von Geschäftsprozessen.
In die Anschaffungskosten gehören die Aufwendungen, die notwendig sind, die Software in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Hierzu zählen auch zurechenbare Personalaufwendungen, die aufgrund der Ermittlung anteiliger Stundensätze direkt zurechenbar sind. Hingegen gehören Schulungsmaßnahmen für den Administrator und die Anwender nicht in die Anschaffungskosten, da die Software bereits vorher objektiv betriebsbereit war. Daher gehören auch Aufwendungen für die Anpassung interner betrieblicher Prozesse und Aufwendungen für die Weiterentwicklung der vorhandenen IT-Infrastruktur- sowie die Übernahme von Altdatenbeständen und deren Prüfung nicht in die Anschaffungskosten.
Der Anschaffungsvorgang ist beendet, wenn der vom Unternehmen beabsichtigte betriebsbereite Zustand erreicht ist. Nachgelagerte Aufwendungen stellen grundsätzlich laufenden Aufwand dar, sofern es sich nicht um eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung handelt, § 255 Abs. 2 HGB.
Handelt es sich um Herstellungskosten, besteht für einen selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstand des Anlagevermögens ein Aktivierungswahlrecht, sofern es sich um Entwicklungsaufwendungen und nicht um Forschungsaufwendungen handelt, § 255 Abs. 2a HGB. Ein explizites Aktivierungsverbot besteht für selbst geschaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten oder vergleichbare immaterielle Vermögensgegenstände- des Anlagevermögens, § 248 Abs. 2 S. 2 HGB. Hierbei ist zu beachten, dass das Aktivierungsverbot nicht für Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens gilt. Bei einer Internetadresse (sog. Domain-Name), handelt es sich um einen nicht abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstand.
Kommt es zur Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, dürfen Gewinne nur ausgeschüttet werden, wenn die nach der Ausschüttung verbleibenden frei verfügbaren Rücklagen zuzüglich eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlustvortrags mindestens den insgesamt angesetzten Beträgen abzüglich der hierfür gebildeten passiven latenten Steuern entsprechen, § 268 Abs. 8 HGB. Durch diese Ausschüttungssperre verhindert der Gesetzgeber die Ausschüttung dieser aktivierten Beträge.
Da steuerrechtlich die Aktivierung von selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unzulässig ist, § 5 Abs. 2 EStG, ist für die auf den Unterschiedsbetrag zu erwartende zukünftige Steuerbelastung eine passive latente Steuer nach § 274 Abs. 1 HGB zu bilden.
Wird hingegen ein Entwicklungsauftrag an einen Dritten vergeben und dieser trägt das Entwicklungsrisiko, so ist damit ein Anschaffungsvorgang gegeben und es besteht eine Aktivierungspflicht.
Beispiel
Die Projektkosten für die Entwicklung einer Software, die im Produktionsbereich zur Steuerung einer Maschinenanlage eingesetzt werden soll, bestehen aus folgenden Bestandteilen:
| Einzelkosten (Material, Löhne und Gehälter) |
1.000 GE |
| Zurechenbare Gemeinkosten |
500 GE |
| Nicht zurechenbare Gemeinkosten |
200 GE |
| Summe der Projektkosten |
1.700 GE |
Nach § 248 Abs. 2 i. V. m § 255 Abs. 2 und Abs. 2a HGB sind 1.500 GE aktivierbar. Fallen Kosten für die Fremdkapitalfinanzierung der Herstellung, Abschreibungen für entwicklungsbezogene Anlagen, Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen für soziale Einrichtung des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche Altersversorgung an, soweit diese auf den Zeitraum der Entwicklung entfallen, so können diese aktiviert werden und bilden die Kostenobergrenze.
| Im Gesamtkostenverfahren ergibt sich folgender Buchungssatz: |
| Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, § 266 Abs. 2 A. I. 1. HGB |
1.500 GE an |
Andere aktivierte Eigenleistungen, § 275 Abs. 2 Nr. 3 HGB |
1.500 GE |
| Der Buchungssatz zur Bildung der passiven latenten Steuern unter Berücksichtigung eines Steuersatzes von 30 Prozent lautet: |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag, § 275 Abs. 2 Nr. 18 HGB |
450 GE an |
Passive latente Steuern, § 266 Abs. 3 E. HGB |
450 GE |
Nach § 268 Abs. 8 HGB kann ein Bilanzgewinn nur ausgeschüttet werden, sofern dieser den Betrag von 1.050 GE (1.500 GE – 450 GE) übersteigt. Eine Ergebnisabführungssperre ergibt sich aus § 301 Abs. 1 AktG.
Unternehmen aus der Softwarebranche weisen einen Umsatzerlös aus dem Vertrieb, der Vermietung bzw. Lizenzvergabe von Software oder der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Software nach § 277 Abs. 1 HGB aus. Der Zeitpunkt der Umsatzrealisation ist der Zeitpunkt, in dem durch das anbietende Unternehmen die Lieferung inklusive des Gefahrenübergangs erfolgt ist oder die Leistung erbracht wurde (z. B. nach Abnahme der Software durch den Kunden), da dann die vertraglichen Bedingungen erfüllt sind und eine Forderung aus Lieferung und Leistung eingebucht wurde.
Aus einem Beitrag von Dirk J. Lamprecht
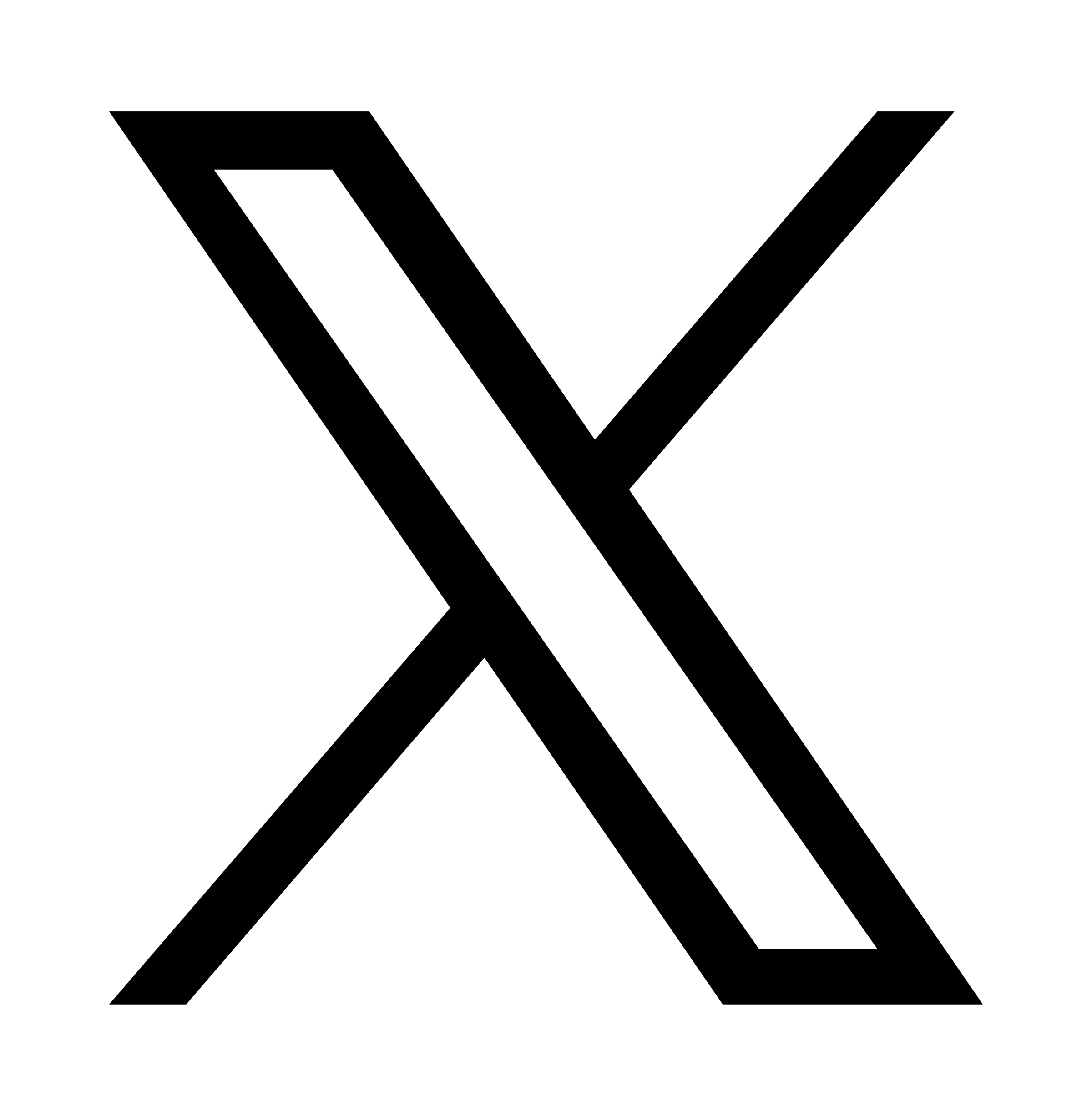 X
X
