Femizide in Deutschland – Plädoyer für die Reform des § 211 StGB
Zitationsverweis
: »Femizide in Deutschland – Plädoyer für die Reform des § 211 StGB« (In: Rechtshandbuch für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, hrsg. von , Auflage 89, Hamburg: Verlag Dashöfer 2024, Abschn. 2.1.1)
Dies ist ein kostenfreier Fachartikel
Sie möchten mit mehr News und Fachinhalten up-to-Date bleiben?
Abonnieren Sie jetzt unseren kostenfreien Newsletter!Wer sind die Täter?
Unter ‚Femizid‘ verstehen Feministinnen in Kulturen, die noch deutlich patriarchalisch konstruiert sind, die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Definiert man so, bleiben in modernen, bereits weitgehend egalitär konstruierten Gesellschaften nur noch ganz wenige Fälle übrig, bei denen man eher die Psychiatrie als den Strafvollzug zu empfehlen geneigt ist. Im Folgenden wird daher lediglich von geschlechtsspezifischer Gewalt gesprochen. Diese gab es zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften. Sie wird in Deutschland seit Ende des 20. Jh. mittels ausgefeilter Programme eingedämmt. Die Befugnisse regelt das Gewaltschutzgesetz und die dafür eingerichteten Netzwerke sprechen von häuslicher Gewalt, die in diese Netzwerke eingebundene Polizei benutzt den Begriff ‚Partnerschaftsgewalt‘.
Im Jahr 2021 zählte das Bundeskriminalamt – BKA – unter der Rubrik ‚Partnerschaftsgewalt‘ 109 getötete Frauen und 12 Männer. Unter den versuchten und vollendeten Tötungen in Partnerschaften führt es 369 Personen auf. Die Muster sind ähnlich. Es dominieren bei Beziehungstaten stark die männlichen Tatverdächtigen. Aktenanalysen zur ‚Partnerschaftsgewalt‘ gibt es jedoch noch keine. Sie sind allerdings geplant. Das KFN Hannover (Projekt ‚Femizide‘ von Kinzig u. a.https://uni-tuebingen.de/universitaet/aktuelles-und-publikationen/attempto-online/newsfullview-attempto/article/femizide-umfassende-studie-zur-toetung-von-frauen-in-deutschland/) wird erst 2025 verlässliche quantitative und qualitative Daten präsentieren können. Die polizeilichen Daten lassen sich – ohne Kontext – nur ganz grob in dem Sinne interpretieren, dass es sich um geschlechtsspezifische Gewalt handelt. Aber mehr lässt sich dazu noch nicht sagen.
Polizeiliche Daten sind notorisch unzuverlässig. Seit den 1980er Jahren wissen wir, dass nicht nur bei sog. Bagatellen, sondern ausgerechnet bei Tötungsdelikten die Selektivität (Schwund zwischen polizeilichen Daten – der PKS (Polizeiliche Kriminalstatistik) – und den Rechtspflege-Daten, insbesondere bei den Versuchen) sehr hoch ist (Sessar 1981). Zwar steht bei den von der Polizei registrierten vollendeten Taten immerhin fest, dass ein Mensch gestorben ist, nicht jedoch folgen daraus die weiteren Voraussetzungen, schon gar nicht der Vorsatz, die Rechtswidrigkeit der Tat (die bei Notwehr nicht gegeben ist) und die Schuldfähigkeit des Täters fest. Bei Partnerschaftsgewalt gibt es zwar selten Zweifel über die Rechtswidrigkeit, da Notwehr- und Notstands-Fälle hier besonders selten sind. Angegriffen wird die Frau schließlich in einer eskalierten Situation und ist eher wehrlos und meist auch eingeschüchtert. Jedoch ist davon auszugehen, dass die Vorstellung, die Tatverdächtigen handelten aus ‚Frauenhass‘, wie oft geschrieben wird, zu schlicht ist. Viele Tatverdächtige im Hellfeld der polizeilich bekannten ‚Partnerschaftsgewalt‘ sind auch in anderen Konstellationen bereits als gewaltbereit registriert worden (so das Ergebnis der allerdings auf Kiel beschränkten Aktenanalyse der Tätigkeit der Staatsanwaltschaften von Bettina Cummerow 2008). Wie schwer gestört oder alkoholisiert die Tatverdächtigen zum Zeitpunkt der Tat waren oder ob sie in eher prekären Verhältnissen leben, das wissen wir nicht. Es ist sicher, dass es auf diesen Stufen zu anderen gerichtlichen Bewertungen kommen wird, als sie die Polizei im Stadium des Anfangs-Verdachts vorgenommen hat. Schließlich ist auch nicht zu erwarten, dass Gerichte in zahlreichen Fällen die Mordmerkmale bejahen werden. Selbst bei den wenigen als Mord abgeurteilten Taten kommt es eher nicht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, da die Täter alkoholisiert oder aus anderen Gründen vermindert schuldfähig sein können.
Der Grund für diese Annahmen folgt aus der Geschichte der Rechtsprechung zum Mord. Seit den 1950er Jahren hält sich trotz aller Kritik die Doktrin, dass es sich bei Mord um einen eigenständigen Tatbestand und nicht um eine Strafzumessungsnorm handelt. Die Folge davon ist, dass die Bejahung eines Mordmerkmals die absolut angedrohte Freiheitsstrafe auslöst. Kommt eine Strafmilderung wegen eingeschränkter Schuldfähigkeit nicht in Betracht, dann gibt es keinen Spielraum mehr für die Strafzumessung. Der reformierte § 46 StGB, der eine Strafschärfung für geschlechtsspezifische Gewalttaten vorsieht, passt nicht für die Auslegung des Mord-Tatbestandes, weil es eine reine Strafzumessungsnorm ist. Sie kann nur im Rahmen einer Verurteilung wegen Totschlages bedeutsam werden, nicht aber bei Mord. Außerdem passen die Merkmale des noch immer nicht reformierten Mordes nicht auf Taten körperlich überlegener und sozial auf Dominanz und Kontrolle fixierter männlicher Täter, welche ihre aktuellen oder früheren Partnerinnen töten. Die Probleme liegen neben der problematischen Rechtsprechung insbesondere in der Entstehungsgeschichte der §§ 211 ff. StGB, der im Folgenden nachgegangen wird.
§ 211 StGB – dieser Paragraf muss erst entnazifiziert werden, damit künftig Gerichte Femizide, also die Tötung von Frauen durch aktuelle oder frühere Partner, angemessen aburteilen können
Die Probleme dieses aus dem Jahr 1941 stammenden Tatbestandes erkennt man schon bei oberflächlicher Lektüre. Er beginnt nicht mit der Tat, sondern mit der Formulierung „Mörder ist, wer …“. Es folgen hoch moralisierende Mordmerkmale und sehr unbestimmte Formulierungen. Noch deutlicher wird die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung, wenn man sich die Entstehungsgeschichte klar macht und die sehr unglückliche Weichenstellung des Großen Strafsenats des BGH – St 9,385 – im Jahr 1956. Die Richter leugneten damals, dass der aus dem Jahre 1941 stammende Paragraf von einer eigenartigen normativen Tätertypologie ausgeht (deshalb die noch heute benutzte gesetzliche Formulierung in § 211: „Mörder ist, wer …“). Die Typisierung erfolgt nicht empirisch, sondern rein normativ, allerdings im Sinne einer ideologischen Betrachtungsweise, die 1941 politisch gewollt war und in eine Gesellschaft passte, welche sich im Krieg befand und in der patriarchale Strukturen auch dann als legitim galten, wenn sie gewaltsam durchgesetzt wurden. Die maskulin formulierten Mordmerkmale tragen die Handschrift dieser hochideologisierten kriegerischen Willkürherrschaft. Dies zeigt sich auch, wenn man fragt, wie die Tötung schwacher und wehrloser Menschen geregelt war. Sie fiel eher nicht unter die Mordmerkmale. Erfasst waren vorwiegend Tötungshandlungen, die nach der damaligen Logik als ‚unmännlich‘, also ‚feige‘ galten oder gar als ‚verächtlich‘ (insofern ‚niedrige Beweggründe‘) bezeichnet werden konnten. Handelte der Täter hingegen offen feindselig, wurde er privilegiert. Seine Tat wurde nicht als ‚heimtückisch‘ angesehen, da das Opfer zwar wehrlos, aber nicht arglos gewesen sei. Auch beim Mordmerkmal ‚grausam‘ wiederholt sich diese widersinnige Logik. Beachtlich war nach der bis ins 21. Jahrhundert geltenden Rechtsprechung nur der letzte Akt der Tötung, nicht hingegen die Vorgeschichte bis zur tödlichen Tat. Ging ihr eine vom Täter zu verantwortende grausame Leidensgeschichte des Opfers voraus, verneinte die Rechtsprechung dennoch das Mordmerkmal ‚grausam‘, weil angeblich die Tötung selbst zwar effizient, aber eben nicht für sich gesehen qualvoll gewesen sei. 1941 waren diese Ergebnisse gewollt; denn damals stand die Änderung der Tötungsdelikte (hierzu Frommel, JZ 1980, 559; ferner dies. Prittwitz-FS 2023. Bestätigt durch die präzise historische Analyse von Plüss 2022) unter dem Eindruck des Krieges und des Kriegs-Strafrechts. Sie war vollständig beherrscht von der NS-Ideologie. Drahtzieher der Reform war Freisler persönlich (so Plüss). Unterschied sich der aus dem Jahr 1871 überkommene Tatbestand des Mordes (§ 211) vom Totschlag (§ 212) lediglich über das Merkmal der Überlegung, also eine rein kognitive Abgrenzung, meinte die Gesetzgebung 1941, sie müsse im Zeichen der NS-Ideologie und des zeitgleich geschaffenen Kriegsstrafrechts mit sog. ‚normativen Tätertypen‘ (also keinen kriminologischen Tätertypen) wie dem ‚Volksschädling‘ und ähnlich ausgrenzenden Formulierungen arbeiten. Der sog. normative Tätertyp des Mörders, der den 1941 geänderten § 211 RStGB prägte, ähnelt nur oberflächlich dem 1937 geschaffenen Schweizer Gesinnungs-Strafrecht. In den 1940er Jahren war die Schweiz für die Nazis kein Vorbild, und es ging in Deutschland zu dieser Zeit um mehr als nur um eine moralisierende Gesetzesänderung. Der Sache nach antizipierte die NS-Gesetzgebung damals bereits die später vor deutschen Gerichten erfolgte Bagatellisierung der Verantwortung sog. Befehlsempfänger bei der Judenvernichtung. Gelungen ist diese Entsorgung der Vergangenheit (bis ins 21. Jahrhundert) u. a. deshalb, weil die Mordmerkmale eben hochselektiv sind und so formuliert, dass sie die Vernichtung wehrloser Menschen eher nicht umfassen. Das war 1941 gewollt und wurde später nicht korrigiert. Demgegenüber dominierte in der Schweiz lediglich ein altertümlicher und traditionaler Zeitgeist. Die unerträglich unbestimmte Formulierung der Mordmerkmale wurde aber später korrigiert. In Deutschland blieb es hingegen beim höchst unbestimmten und durch die absolut angedrohte lebenslange Freiheitsstrafe sehr schwer praktizierbaren normativen Tätertyp des Mörders. Die Rechtsprechung versuchte zwar mit einer komplizierten Umdeutung des 1941 geschaffenen NS-Strafrechts praktikabel zu bleiben, aber dies gelang letztlich nicht und kann auch bei der Tötung von Partnerinnen nicht gelingen. Zu starr ist die absolut angedrohte Freiheitsstrafe. 1941 war dieser Rigorismus erwünscht. Das Ziel war deutlich. Die herkömmliche (national-liberale) Tatbestandslogik sollte durch eine zur NS-Ideologie passende Lehre von der Täterschuld (deshalb die Konstruktion normativer Tätertypen) ablösen und damit die Rechtsprechung im Sinne des NS-Systems dynamisieren. Nur deswegen umschrieb die Formel von den ‚niedrigen Beweggründen‘, welche noch heute die Auslegung prägt, einen Typus von Tätern, welcher bei der Tötung nicht nur das Leben eines anderen Menschen auslöscht, sondern darüber hinaus ‚Verachtung‘ verdient. Es ist dies eine in einem Tatstrafrecht unsägliche Formel, die aber dennoch heute gebräuchlich ist, auch wenn sich die Inhalte je nach Zeitgeist wandeln und die Rechtsprechung versucht die peinliche Geschichte zu verdecken. Da aber schon die Sprache verräterisch ist, verwundert die Beharrlichkeit, insbesondere von Feministinnen, die sich schlicht auf eine angeblich ‚gefestigte Rechtsprechung‘ beziehen, ausgerechnet diese Tradition zur Bekämpfung männlicher Gewalt nutzen zu wollen.
In der NS-Zeit wurde Verachtung nur solchen Tätern entgegengebracht, welche die ‚völkischen‘ Überzeugungen verfehlten. Nach 1945 wurde demgegenüber frei moralisiert, da es nun keine verbindlichen Inhalte mehr gab, sondern nur noch eine diffuse Bereitschaft zu moralisieren.Der mit 97 Jahren 2023 verstorbene berühmte Strafverteidiger Heinrich Hannover schildert diese Neigung plastisch: https://taz.de/Das-NS-Erbe-im-Strafrecht/!5068925/ Es war vorhersehbar, dass das Mordmerkmal der ‚niedrigen‘ Beweggründe mit der Zeit zu einer Leerformel wird, die von Gerichten gefüllt werden muss und dabei auch verändert wurde und wird. Doch legitimiert die richterliche Aktualisierung nicht die gesetzliche Grundlage. Es ist doch klar, dass ein solcher Auslegungsprozess nicht frei ist, sondern ideologisch bleibt; denn letztlich ist er an das geschriebene Gesetz und die in ihm angelegten Mängel gebunden.
Dies zeigte sich auch an anderen Mordmerkmalen, insbesondere dem der Heimtücke. Im 20. Jahrhundert (vor der Rechtsprechungswende 2011 – dem Demjanjuk-ProzessZuletzt wurde im Dezember 2022 eine ehemalige Sekretärin im NS-Konzentrationslager Stutthof, die im Vorzimmer des Lagerleiter tätig war, wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.500 Fällen schuldig gesprochen worden. Da sie zum Zeitpunkt ihrer Tätigkeit in Stutfhof noch minderjährig war, wurde sie zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren auf Bewährung verurteilt.) verneinten die Strafgerichte bei NS-Schreibtischtätern die Beihilfe zum tatbezogenen Heimtücke-Mord. Da sie unwidersprochen behaupten konnten, sie hätten nur ihre Befehle ausgeführt, selbst aber keinen Rassenhass verspürt (also nicht aus niederen Beweggründen gehandelt), wurden sie sehr nachsichtig behandelt. Die Rechtsprechung folgte – wenn auch aus anderen Gründen – der NS-Gesetzgebung und ging davon aus, dass ‚heimtückisch‘ nur der ‚feige‘ Mörder handele, der nicht offen feindselig einen ‚Gegner‘ oder „Gemeinschaftsfremden“, um es drastisch in einer nationalsozialistischen Sprache auszudrücken, auslöscht, sondern sich – der männlichen Norm nach ‚abweichend‘, nämlich ‚tückisch‘ verhält. Literarisch umgesetzt findet man solche archaischen Weltbilder im germanischen Kulturkreis, etwa im Nibelungenlied, dem Mythos vom tapferen Siegfried, der den Heldentod stirbt, weil der heimtückische Hagen ihn mittels einer Intrige und Täuschung hinterrücks ermordete. Selbst wenn man, was die Rechtsprechung nach 1945 getan hat, diesen ideologischen Hintergrund mit neuen Formeln überdeckt, so bleibt doch die selektive Fassung der Norm und die maskuline Sprache übrig, welche auf die Tötung wehrloser Frauen in der Partnerschaft bzw. nach einer Trennung nicht passt und wohl auch nicht so leicht passend gemacht werden kann, um die Dynamik zu bewerten, welche hinter geschlechtsspezifischer Gewalt steckt.
Zweifellos geht es um geschlechtsspezifische Gewalt. Allerdings macht die Definition, wonach Frauen getötet würden, weil sie Frauen sind, keinen Sinn. Was das BKA (Bundeskriminalamt) ‚Partnergewalt‘ nennt, ist soziologisch betrachtet eine Gewalt-Dynamik, welche von Geschlechterstereotypen geprägt ist. Unübersehbar ist der Aspekt der männlichen Kontrolle über die – im Stereotyp – untergeordnete Partnerin. Gesteigert wird diese Asymmetrie durch den männlichen Besitzanspruch, der überlagert wird von anderen Motiven. Drastisch wird die Eigenständigkeit von Frauen grundsätzlich und spezifisch bei der eigenen bzw. früheren Partnerin geleugnet. Versucht man diesen Befund in einer allgemeineren Sprache auszudrücken, kann man mit Reemtsma (Jan Philipp Reemtsma, Vertrauen und Gewalt, 2009) Gewaltformen unterscheiden und für gewalttätiges Handeln, das im wesentlichen Einschüchterung und Unterordnung anstrebt und das die „Zerstörung der Integrität des Körpers“ als Mittel der Unterwerfung einsetzt, ‚autotelische Gewalt‘ nennen. Sie unterscheidet sich von der instrumentellen Gewalt, die nicht den ganzen Menschen in seiner Würde vernichten will, sondern punktuell zu etwas zwingt, was dieser nicht will (Reemtsma S.116 ff.). Übertragbar ist dies auf Femizide, welche sich nicht auf instrumentelle Zwänge beschränken, sondern darüber hinausgehen, selbst über das, was bei einer Vergewaltigung geschieht, und das Opfer als Person, nicht nur als Körper zerstören. Der Unterschied in den Begrifflichkeiten liegt im Anspruch der jeweiligen Theorie. Während die feministische Terminologie genauer bestimmen will, was unter Heteronormativität oder klassisch unter Patriarchat zu verstehen ist, versucht Reemtsma alle autokratischen Praktiken unter einen abstrakten Begriff, den des Autotelischen, zu subsumieren.
Kann man autotelische oder geschlechtsspezifische Gewalt unter das Merkmal der „niedrigen Beweggründe“ subsumieren?
Versuche, den nicht reformierten § 211 StGB so auszulegen, dass sog. Femizide wegen Mordes aus ‚niedrigen Beweggründen‘ bestraft werden, gibt es (so Leonie Steinle für die Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes). Typischerweise ignorieren sie zwei wesentliche Aspekte:
-
Zum einen fehlen Hinweise darauf, wie mit der normativen Tatsache umgegangen werden soll, dass immer dann, wenn ein Mordmerkmal bejaht wird, die lebenslange Freiheitsstrafe – ohne Abstufung – verhängt werden muss.
-
Zum anderen wird die Geschichte, die 1941 herrschende NS-Doktrin übersehen.
-
Auf diese Weise wird die Systematik der Tötungsdelikte des noch immer geltenden Rechts verfehlt. Historisch bedingt gilt noch immer ein qualitativer Unterschied. Die reformierte Strafzumessungsregel in § 46 Abs. 2 StGB betrifft nicht das Unrecht, sondern nur die Strafzumessung. Sie erlaubt es geschlechtsspezifisch motivierte Delikte härter zu bestrafen. Mordmerkmale hingegen gelten als Unrechtsmerkmale (oben wurde bereits erwähnt, dass diese Doktrin aus dem Jahr 1956 stammt – Großer Strafsenat BGH-St 9,385 und nie offen als unangemessen abgeschafft wurde).
Insbesondere schafft die absolut angedrohte lebenslange Freiheitsstrafe, bejaht man § 211 trotz aller Probleme, unlösbare Fragen. Dies gilt zwar für die gesamte Rechtsprechung, aber gesteigert bei der Tötung einer Frau durch den aktuellen oder früheren Partner. Typisch für diese Form der Gewalt ist ein Motivbündel beim Täter. Folgt aber zwingend die lebenslange Freiheitsstrafe, wenn „niedrige Beweggründe“ bejaht werden, weil der Täter seine Partnerin patriarchal kontrollieren wollte, müssen Motive, die eher strafmildernd sind, Verzweiflung, psychische Störungen, welche die Schuldfähigkeit nicht ausschließen oder im Sinne von § 21 StGB mindern, berücksichtigt werden, ansonsten wäre eine solche dogmatisch verfahrende Sanktionspraxis unverhältnismäßig.
Wer ‚Femizide‘ angemessen beurteilen will, muss §§ 212, 46 Abs. 2 StGB (besonders schwere Fall des Totschlags) anwenden
Betrachtet man das unangemessene System der Tötungsdelikte, läuft die Kritik an der angeblich ‚zu milden‘ Rechtsprechung ins Leere. Einen Ausweg bilden könnten hingegen transparente Strafzumessungen im Rahmen von § 212 Abs. 2 StGB (Kann-Vorschrift). Danach kann im Einzelfall eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden, wenn die Tat – mit Blick auf die Strafzumessungsregel des reformierten § 46 Abs. 2 StGB – besonders schwer wiegt, weil es sich um geschlechtsspezifische Gewalt handelt. Lediglich bei Tötungen aufgrund eines sadistischen Frauenhasses könnten demnach ‚niedrige Beweggründe‘ bejaht werden. Unwahrscheinlich ist es aber, dass diese Konstellation bei Fällen der Tötung des Intimpartners häufig auftreten. Dort sind eher Taten zu erwarten, hinter denen ein Motivbündel steckt, das zwar starke patriarchale Relikte aufweist, aber eher nicht auf diese reduziert werden kann.
Tödlich endete Gewalt gegen Frauen ist nach der PKS eher selten, Körperverletzungen und Stalking hingegen häufig
Im Jahr 2021 registrierte die Polizei unter der Rubrik ‚Partnergewalt‘ ca. 143.000 Fälle, meist Körperverletzungen. Mehr als die Hälfte betrafen Trennungs-Stalking und Straftaten gegen eine mittlerweile getrennt lebende frühere Partnerin. Die von der Polizei als versuchte oder vollendete Tötungen registrierte Taten betragen danach nur 0,3 Prozent aller Fälle. Da die Kooperationsmodelle gegen ‚häusliche Gewalt‘, welche zur Implementierung des 2002 in Kraft getretenen Gewaltschutzgesetzes gebildet wurden, Absprachen über die Meldung an die Polizei getroffen haben,Das Gewaltschutzgesetz sieht familiengerichtliche Schutzanordnungen vor. Die Polizei hat die Befugnis Zwangsmittel einzusetzen (Wegweisungen). Sie erhebt die Daten und meldet sie über die Länder an das BKA. Eingebettet in diese Kooperation sind Frauenberatungsstellen, die Rechtsberatung der Amtsgerichte und anwaltliche Notdienste. Koordiniert werden die Aktivitäten meist vom Frauenministerium des jeweiligen Landes. hängt die statistische Erfassung davon ab, ob eine Frau eine Schutzanordnung beantragt (zuständig für Schutzanordnungen sind die Familiengerichte, Wegweisungen erfolgen durch die Polizei). Die Polizei meldet bekannte Fälle auch dann, wenn keine Strafanzeige der Frau vorliegt, was sehr häufig ist. Die Daten in Deutschland, Österreich und den Niederlanden sind daher vergleichsweise leicht zugänglich. Auch die Wirksamkeit der Maßnahmen ist gut evaluiert (Martina Rupp 2005). Doch bleiben offenbar besonders schwere Fälle übrig, bei denen keine spezifische Reaktion erfolgt, welche die Gefährdung der Frau reduziert. Wieso das so ist, dafür gibt es viele Anzeichen. Auffallend viele Körperverletzungs-Verfahren richten sich gegen bereits anderweitig Vorbestrafte und gegen tatverdächtige Männer, gegen die noch andere Verfahren anhängig sind. Sie werden meist nach § 154 Strafprozessordnung eingestellt. Dies ist ein Grund, weswegen diese Männer nicht aufgefordert werden, sich in eine Tätertherapie zu begeben bzw. sie sind für die Sozialtherapeuten nicht erreichbar. Umgekehrt resignieren offenbar ausgerechnet die besonders gefährdeten Frauen. Häufig fehlt es an Geldmitteln, um für sich und Kinder eine Wohnung zu finden. Auch dürften sie eher wenige oder fast keine sozialen Kontakte haben. Diese Frauen befreien sich seltener aus ihrer Gewaltbeziehung, stellen auch keine Anträge an das Familiengericht oder Strafanzeigen. Rein rechtlich könnte nämlich bei schweren Fällen des Stalkings durch einen Ex-Partner oder andere schwere Straftaten von der StA Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr angeordnet werden. Tatsächlich finden sich hierzu keine Angaben, schon gar keine Urteile, welche die Grenzen der Zulässigkeit dieser Untersuchungshaft definieren, so dass davon auszugehen ist, dass der Schutz bei diesen späteren Opfern versagt hat. Begünstigt wird dies dadurch, dass die Koordination in fast allen Bundesländern durch die für die Frauenberatungsstellen zuständigen Ministerien erfolgt. Wäre das Justizministerium zuständig, könnten leichter Anweisungen an die Staatsanwaltschaften ergehen.
Verhältnis von § 46 StGB und §§ 211 StGB
De lege lata können Strafgerichte bei besonders schweren Fällen des Totschlags, auch wenn keine Mordmerkmale bejaht werden, eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängen. Zwar wird § 212 Abs. 2 StGB in der Praxis so gut wie nie angewandt, aber die Strafzumessungsnorm des § 46 Abs. 2 StGB ist neu und die Debatte hat noch nicht eingesetzt. Die Praxis könnte sich also ändern.
Dennoch wäre es klarer, wenn die Gesetzgebung § 211 StGB entsprechend ändern würde. Ein Vorbild wäre die Strafzumessungslösung des Alternativ-Entwurfs Leben (GA 2008, 193). Sie sah Mord als Grundtatbestand vor, hatte jedoch die absolute Strafdrohung ‚lebenslang‘ gestrichen und differenzierte stattdessen. Jedoch hatte sie, was damals kaum diskutiert wurde, bei geschlechtsspezifischer (und auch rassistischer) Gewalt eine Privilegierung der Strafdrohung des Grundtatbestand des Mordes ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Angeklagten nachvollziehbar strafmildernde Gesichtspunkte nannten. Verzichtet wurde auf subjektive Merkmale. Entscheidend für das Versagen der Privilegierung war, dass die Tat seine Gefährlichkeit dokumentierte. Diese Konzeption passt zum reformierten § 46 StGB. Doch verzichtete die Gesetzgebung anlässlich der Änderung des § 46 StGB auf eine Reform der §§ 211 ff. StGB. Dass sie auf die entstandenen Wertungswidersprüche nicht geachtet hat, ist eigentlich nicht zu erklären. Nachvollziehbar ist jedoch, dass man nicht auf die Vorlage der Alternativprofessoren des Jahres 2008 zurückgegriffen hat. Offenbar gingen alle Beteiligten davon aus, dass die Weigerung der bayerischen Staatsregierung, die absolut angedrohte lebenslange Freiheitsstrafe bei Mord zu streichen, in Stein gemeißelt sei. Zwar platzte im Jahr 2014 die geplante Reform. Doch gibt es eigentlich keinen Grund mehr für diese Rücksichtnahme. Die Strafzumessungsregel des § 46 StGB und die Legende vom Tatbestandsmerkmal der ‚niedrigen Beweggründe‘ widersprechen sich dogmatisch und passen auch rechtspolitisch nicht zusammen. Es ist Zeit für eine transparente Strafzumessung bei allen Tötungsdelikten.
Literaturhinweise
Bettina Cummerow, Strafverfolgung bei häuslicher Gewalt. Eine empirische Untersuchung der strafrechtlichen Reaktionen auf häusliche Gewalt“, Dissertation, elektronisches Veröffentlichungsverzeichnis MACAU der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 2008.
Monika Frommel, Der „Mörder“ – eine exemplarische Figur des NS-Tätertyps, Festschrift für Prittwitz, erscheint 2023.
Monika Frommel, Die Tätertypenlehre bei der Reform des § 211 StGB im Jahre 1941, JZ 1980, 559.
Plüss, Martina, Der Mordparagraph in der NS-Zeit. Zusammenhang von Normtextänderung, Tätertypenlehre und Rechtspraxis – und ihr Bezug zu schweizerischen Strafrechtsdebatten (= Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts 97), Tübingen: Mohr SIebeck 2018.
Jan Philipp Reemtsma, Vertrauen und Gewalt. Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne, Hamburger Edition 2008.
Martina Rupp, Rechtstatsächliche Untersuchung zum Gewaltschutzgesetz, Köln: Bundesanzeiger 2005.
Klaus Sessar, Rechtliche und soziale Prozesse einer Definition der Tötungskriminalität, Freiburg im Breisgau: Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht, 1981.
Zitierte Paragrafen
§ 211 Mord
(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
(2) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.
§ 212 Totschlag
(1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.
(2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen.
§ 46 Grundsätze der Strafzumessung
(1) Die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe. Die Wirkungen, die von der Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, sind zu berücksichtigen.
(2) Bei der Zumessung wägt das Gericht die Umstände, die für und gegen den Täter sprechen, gegeneinander ab. Dabei kommen namentlich in Betracht:
die Beweggründe und die Ziele des Täters, besonders auch rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische oder sonstige menschenverachtende,
die Gesinnung, die aus der Tat spricht, und der bei der Tat aufgewendete Wille,
das Maß der Pflichtwidrigkeit,
die Art der Ausführung und die verschuldeten Auswirkungen der Tat,
das Vorleben des Täters, seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie
sein Verhalten nach der Tat, besonders sein Bemühen, den Schaden wiedergutzumachen, sowie das Bemühen des Täters, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen.
(3) Umstände, die schon Merkmale des gesetzlichen Tatbestandes sind, dürfen nicht berücksichtigt werden.

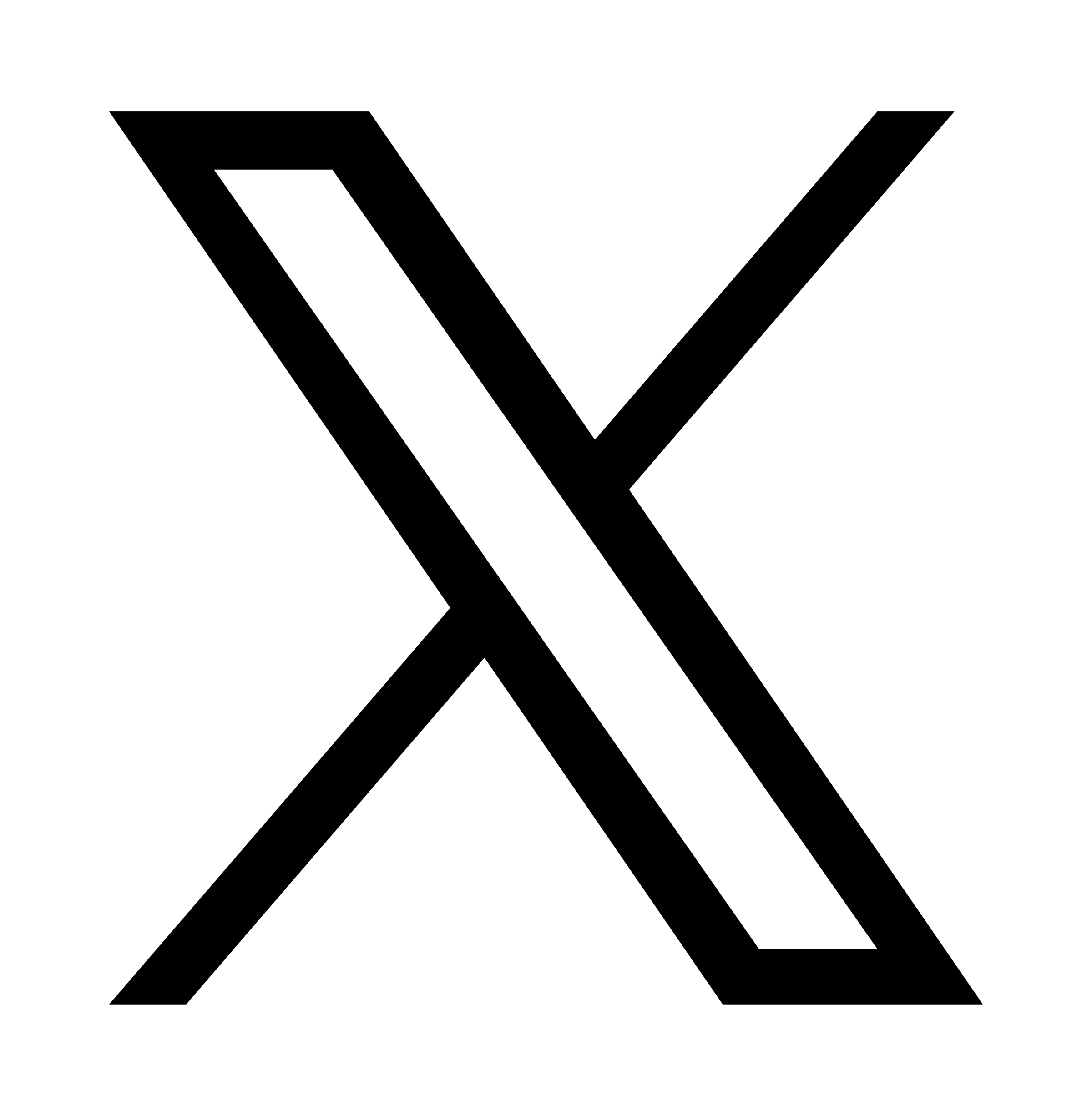 X
X
